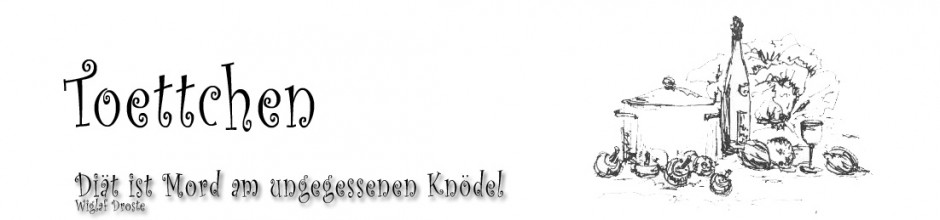Ich war das erste mal im Leben so richtig im Schwäbischen. So richtig heißt: um einiges hinter Stuttgart. Die Ränder hatte ich ja schon mal geschrammt. Eigentlich komme ich ja aus Westfalen und das sitzt tief drinnen. Nun lebe ich schon Jahrzehnte im Badischen, unter anderem im tiefsten Hotzenwald. Das färbt ab, besonders wenn es um die Einschätzung von Menschen aus dem Landesteil Württemberg geht. Kurz und gut, es war gar nicht so schlimm. Auch dort leben Menschen, ganz nette sogar. Aber das Essen, manchmal gut und manchmal – oh je!
Am Bodensee ist es wahrscheinlich auch nicht viel besser, wenn man das falsche Gasthaus erwischt. Anbei – Bodensee und Schwaben. Ich hatte eine Zeit lang eine Nachbarin, eine Bäuerin, die am Wochenende mit einem Stand am Straßenrand ihre Kirschen und anderes Obst verkaufte. Wenn ein Auto hielt, bestimmte das KfZ Kennzeichen den Preis. Der günstigsten bekamen Einheimische, den mittleren Touristen mit badischen Kennzeichen. Stuttgarter und was dort noch sonst so kreucht und fleucht zahlten einen Schwabenaufschlag. Sie wußten es allerdings nicht. Man erzählt sich, die kommen am Wochenende um das Boot zu putzen. Bringen ihr Vesper mit, lassen kein Geld liegen und fahren vor allen Dingen mit ihrem Boot nicht auf den See. Das könnte ja Benzin kosten. Aber lassen wir diese Vorurteile, zurück zur schwäbischen Küche.
In Backnang war ich in zwei Gaststätten. „Der Storchen“ sei jedermann zu empfehlen. Ein schönes Lokal, da habe ich mich sofort wohl gefühlt, und die Maultaschen waren wirklich hervorragend. Leider ist das Foto nicht so gut, dafür war die Schorle mit einem guten Teil Weißherbst sehr lecker und trägt wohl etwas zur Unschärfe im Bild bei.

Am Abend wurde in einem sogenannten noblen Restaurant als Vorspeise (Suppe) eine Abart des Gaisburger Marsch angeboten. Logischer weise hieß dieser Eintopf lokal eingefärbt Backnanger Marsch. Und wäre ich nicht am Vormittag im Storchen belehrt worden, dass es sehr gutes Essen in Schwaben gibt, hätte ich sofort das alte Vorurteil wieder zum Leben erweckt und leise gemurmelt: „Diese Abart ist ganz schön abartig!“ Genießbar war es auf jeden Fall nicht.
Nun, der Gaisburger Marsch ließ mich nicht los. Zurück im Badischen las ich erst einmal nach, was da so hineingehört. Dazu gibt es viele schöne Anekdoten, die sich um dieses typisch schwäbische Gericht ranken. Die lasse ich heute weg, davon stimmt ja die Hälfte nicht. Ich denke für mich, dass dieser Eintopf als ein herrliches Resteessen geschaffen wurde. Als kräftiger Eintopf ist er ein wirkliches Erlebnis.
Zutaten und Zubereitung:
auf jeden Fall braucht man eine kräftige Rindsbrühe mit dem dazugehörigen Suppenfleisch, Spätzle und Kartoffeln.
500 g Rindssuppenfleisch (Querrippe odere von der Wade), 2 Rindermarkknochen oder Rindersuppenknochen, 2 große Karotten, 1/4 Knolle Sellerie, 1 Petersilienwurzel, Lauch, 1 Zwiebel, 2 Nelken, 1 Lorbeerblatt, 3 ganze Piment, Petersilie, Salz, Pfeffer, Wasser
Gemüse putzen und gemeinsam mit den Knochen, dem Fleisch und den restlichen Zutaten in einen Topf geben. Die Zutaten mit Wasser bedeckt zugedeckt so lange köcheln lassen, bis das Fleisch gar ist. Man kann zwischendurch den Schaum abschöpfen. Wenn man es nicht eilig hat und langsam gart, gibt es kaum Schaum. Vor dem Weiterverarbeiten entferne ich das Suppengemüse und die Gewürze.
Als Einlage sind Spätzle, Kartoffeln, Möhren und Röstzwiebeln ein muss. Die Kartoffeln werden separat gegart, die Spätzle kaufe ich in der Regel im Fertigpack. Aber bitte nicht die getrockneten, sondern frische Spätzle. Fertige Röstzwiebeln gehen gar nicht, die sollte man generell nicht benutzen. Die Möhren werde in Stifte geschnitten in der Brühe gegart, die Spätzle darin erhitzt, die garen Kartoffelstücke gebe ich zum Schluss hinzu. Die Zwiebeln in Ringe schneiden und rösten. Die kommen als allerletztes auf den Eintopf.
Das Fleisch habe ich nicht vergessen, in mundgerechte Stücke geschnitten wird es mit den Spätzle und Möhren in die Suppe gegeben.
Abschmecken und eigentlich wären wir fertig. Nicht ganz, es ist keine Sünde, weiteres Gemüse hinzuzufügen. Ich mag gerne vorgegarte Blumenkohlröschen, Zuckerschoten und auch grüne Bohnen als Ergänzung.
Ein Glas Muskattrollinger dazu ist kein Fehler!